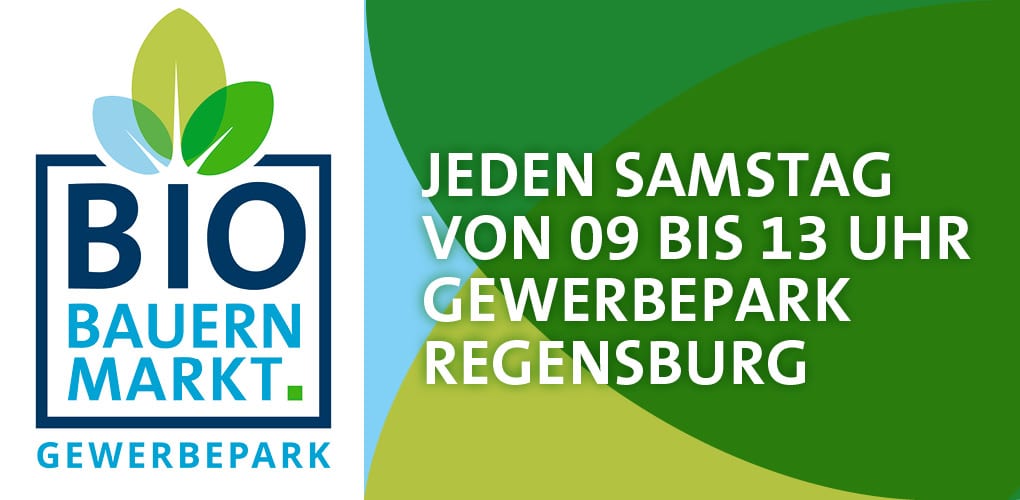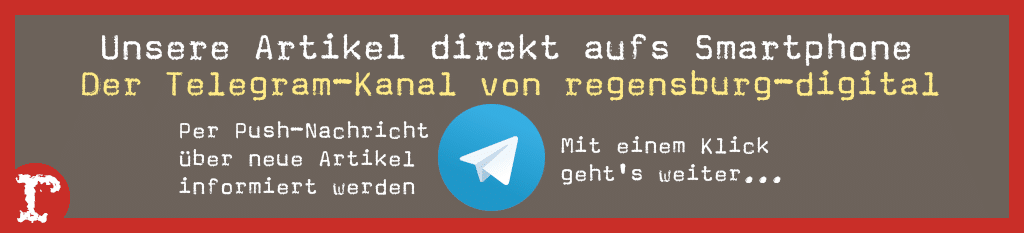Ein Eberhoferkrimi der anderen Art
„Sturm kommt auf“: Josef Hader und Sigi Zimmerschied in einer Oskar-Maria-Graf-Verfilmung (in der ZDF-Mediathek).

Mal alles andere als komödiantisch: Josef Hader und Sigi Zimmerschied in Sturm kommt auf. Foto: ZDF/Fabio Eppensteiner
Die schlechte Nachricht zuerst: Der neue Film mit Josef Hader als Hauptdarsteller ist ein Fernsehfilm. Das heißt, Josef Hader wird nicht nach Regensburg ins Garbo kommen, wie er es bei jedem Kinofilm auf Einladung von Achim Hofbauer tut. Aber jetzt zur Guten Nachricht: Ja eben! Es gibt einen neuen Film mit Josef Hader in der Hauptrolle! Wenn auch nur einen Fernsehfilm…
Ein dreistündiger Spielfilm über einen Schuster? Über einen Dorfschuster vor hundert Jahren, der meistens nichts sagt? Und wenn er mal was sagt, dann benutzt er Wörter, die außer ihm niemand versteht, Wortschöpfungen wie „A-bopa“? Wer dreht so einen Film? Und wer schaut sich sowas an?
3.600 000 Zuschauer bei der Erstausstrahlung
Vier Millionen Zuschauer dürften „Sturm kommt auf“ bereits gesehen haben. Die Erstausstrahlung auf ORF2 am 22./23. Oktober wurde von gut 600.000 Personen verfolgt, das ZDF folgte am 10./11. November und erreichte gut drei Millionen Zuschauer.
„Sturm kommt auf“ in der Mediathek
Seitdem ist der Zweiteiler von Matti Geschonneck (Regie) nach dem Drehbuch von Hannah Hollinger in der ZDF-Mediathek (bis 10.11.2026).
Ist das nicht der Eberhofer?
Liegt’s vielleicht an Sebastian Bezzel? Der mit der Figur des Ludwig Allberger immerhin eine tragende Figur spielt, wenn auch nicht die Hauptrolle? Denn den Franz Eberhofer, den schaun doch immer Millionen an.
Ein Eberhoferkrimi der anderen Art
Aber es ist etwas komplizierter. Zwar ist in „Sturm kommt auf“ auch Frederic Linkemann mit von der Partie, der in den Eberhofer-Krimis nur die Nebenrolle des Polizeiobermeister Karl Stopfer spielt (ein Freund und Kollege von Franz Eberhofer).
Der „Sturm“ ist kein Naturereignis
Hier hingegen, in „Sturm kommt auf“, mischt Frederic Linkemann als Silvan Heingeiger jun. gehörig mit: Er firmiert als SA-Sturmführer und ist somit buchstäblich und zwangsläufig eine Hauptfigur des Films. Silvan Heingeiger jun. ist der direkte Kontrahent des Sozialisten Ludwig Allberger.
Vater gegen Sohn
Eine tödliche Gegnerschaft. Genauso tödlich allerdings wie das Verhältnis von Silvan Heingeiger jun. zu Silvan Heingeiger sen. Denn letzterer ist nicht nur der Großbauer, sondern wird auch noch zum Bürgermeister gewählt. Und außerdem gespielt von Sigi Zimmerschied. Der damit – jetzt wieder eberhoferkrimimäßig abgeleitet – vom Dienststellenleiter Moratschek stracks zum Helden avanciert.
Aus Sigi wird Ernst
Wobei sich zeigt, dass Zimmerschied als Dienststellenleiter Moratschek überqualifiziert bzw. unterbesetzt ist. Nichts gegen die Eberhoferkrimis! Aber wenn man „Sturm kommt auf“ gesehen hat, begreift man erst, was Zimmerschied für ein Schauspieler ist. Wenn er mal nicht den Kasper vom Dienst macht. Sondern wenn es ernst wird. Dann läuft der Mann erst zu voller Form auf.
Ein Mensch namens Schuasta
Doch das Entscheidende ist Sigi Zimmerschieds Gegenüber. Sein Nachbar im Dorf. Das ist nämlich der Schuster. Der wo meistens wenig sagt. Der Schuster Julius Kraus. Der allerdings auch meistens gar keinen Namen nicht hat. Sondern selbst von ihm sehr vertrauten Personen nur „Schuasta“ genannt wird.
Starring: Josef Hader
Und das ist nämlich der Josef Hader. Der wirkliche Held der ganzen Geschichte. Um den sich alles dreht. Und auch bei dem ist es wieder ähnlich wie bei Zimmerschied. Selbstverständlich ist Josef Hader ein begnadeter Kabarettist und ein dito Filmschauspieler. Hader als Brenner in den Wolf-Haas-Verfilmungen – wer hätte das besser machen können. Und doch: Josef Hader als Julius Kraus, wieder andere Geschichte.
Ein Mensch, der sich selbst verschwinden lässt
Denn diese Geschichte hat nichts Komödiantisches, nichts Satirisches. Und wenn Simon Brenner ein Underdog ist, ein Mann des Understatements, dann ist Julius Kraus ein Nichts, ein Niemand. Einer, der sich komplett wegduckt. Der aber im Gegensatz zu all den gutbürgerlichen Duckmäusern seine Gründe dafür hat. Ein Mensch, der seine eigene Existenz schon zu Lebzeiten auszuradieren versucht. Weil das seine einzige Chance ist, vielleicht zu überleben.
Dem Schuster sein Geheimnis
Warum? Das ZDF bewirbt seinen Film so:
„Nach dem 1. Weltkrieg bringt der erstarkende Nationalsozialismus Unfrieden in ein kleines bayerisches Dorf. Der genügsame Schuster Kraus versucht, sich herauszuhalten, doch er birgt ein Geheimnis.“ Nur, was ist das für ein Geheimnis, das der Schuster „birgt“?
Trailer? Spoiler!
Direttamente neben dieser Kurzbeschreibung kann man den einminütigen Trailer anklicken („Drama-Film-fesselnd-1 Min.-2025-ZDF“), und man kann allen, die immer schon vor dem Krimi wissen wollen, wer der Mörder ist, nur zurufen: Ja! Schaut euch den Trailer an! Dann wisst ihr bescheid!
Das Dorf weiß alles – fast
Allen anderen sei dringend abgeraten. Denn das ist der Witz der ganzen Geschichte, dass das ganze Dorf nicht weiß, was mit dem Schuster ist, und dass es auch lang nicht danach fragt, das Dorf. Denn „Geheimnisse werden nicht unbedingt interessanter, wenn man sie kennt“, wie es in einem aktuellen Fachbuch dazu fachmännisch heißt.
Eine harte Welt mit Nischen
Anders gesagt: Vor hundert Jahren, auf dem Dorf, da ging es gnadenlos zu, saugrob und knüppelhart. Und doch gab es manche Dinge, an die man nicht rührte, die man sein ließ, Nischen, die dem harten Zugriff entzogen blieben. Bis die Nazis kamen.
„A-bopa“: Immer der selbe Schwindel
Womit endlich verraten sei, der Spoiler sei erlaubt, was der Schuster mit „A-bopa“ meint:
„Immer der selbe Schwindel“, erklärt Julius Kraus, als ihn der Dorfwirt fragt, was denn das bedeuten solle, dieses „A-bopa“. Daraus wird man natürlich noch nicht schlau.
Die ganzen Widerwärtigkeiten vom Staat
Aber er gibt dann doch noch nähere Erläuterungen:
„A-bopa, damit meint man alles, was einem rechtschaffenen Menschen das Leben verbittern kann… Mit einem Wort, die ganzen Widerwärtigkeiten vom Staat, von den Ämtern, vom Gericht und der Polizei – das ist A-bopa… Auf sowas muss man sich nicht einlassen.“
„Unruhe um einen Friedfertigen“
Dieses Zitat ist jetzt nicht aus dem Film, sondern aus der Romanvorlage. Denn „Sturm kommt auf“ ist die Verfilmung des Romans „Unruhe um einen Friedfertigen“ von Oskar Maria Graf. Der 500-Seiten-Roman erschien 1947 in New York (auf Deutsch), wo Graf auf der Flucht vor den Nazis 1938 gelandet war.

Schutzumschlag der 1986 im Aufbau Verlag erschienenen Ausgabe mit Klappentext.
Rückkehr nach Bayern – nur besuchsweise
Und wo er bis zu seinem Tod 1967 blieb. Viermal besuchte Oskar Maria Graf noch seine alte Heimat, schaute nach, was aus seinem München und seinen Münchnern geworden war. Es bewog ihn nicht dazu, aus dem Exil zurückzukehren.
I would like to have a Weißwurst with a Brezen!
Dabei waren die Lebensumstände des 1894 in Berg am Starnberger See geborenen Bäckerssohnes (und gelernten Bäckers) in New York alles andere als rosig. Graf tat sich schwer mit dem Englischlernen, vielleicht versuchte er es auch gar nicht ernsthaft. Es gab in New York genug andere Exilanten aus Deutschland und Österreich, mit denen man zusammensitzen konnte.
New York, wo es gar nicht hip ist
Oskar Maria Graf wohnte all die Jahre im nördlichsten Zipfel Manhattans in einem sechsstöckigen Backsteinkomplex, 34 Hillside Avenue; der Bau steht noch. Das genaue Gegenstück zu Thomas Manns mondäner Villa in Los Angeles (auch sie steht noch, hat sogar die Feuersbrunst im Januar 2025 überlebt). Freilich gab es deutsche Schriftsteller im Exil, die noch viel einfacher lebten.

34 Hillside Avenue in New York. In diesem Haus lebte Oskar Maria Graf von 1938 bis zu seinem Tod 1967. Foto: Marcinkus
Einhelliges Lob von den Gebrüdern Mann
Thomas Mann äußerte sich übrigens begeistert über „Unruhe um einen Friedfertigen“ („muß ich Sie beglückwünschen zu dem Gelingen dieser prachtvollen Erzählung“), sein Bruder Heinrich genauso („ich fand mich in der – nicht mehr häufigen – Kunst der Meister“).
Bespitzelung durch das FBI
Zu allem Überfluss war auch noch das FBI hinter Graf her. 15 Jahre lang, von 1943 bis 1958, wurde der Schriftsteller aus Bayern als Kommunist verdächtigt und entsprechend bespitzelt. Erst viele Jahre nach seinem Tod rückten die Behörden ein paar Seiten aus der Akte Graf heraus.
„Unter der Maske eines Bier trinkenden Bauerndichters“
Da beschreibt ein Spitzel Graf „as one of the most cunning Moscow agents under his mask of a harmless, jovial, beer-guzzling Bavarian peasant writer“, also „als einen der gerissensten Agenten Moskaus unter seiner Maske eines harmlosen, gemütlichen, Bier trinkenden Bauerndichters“.
Vieles an Trump ist alles andere als neu
Alles, was nicht aggressiv nationalistisch und nicht rechtsextrem ist, wird als „Kommunist“ (wahlweise „schwul“) zur Fahndung ausgeschrieben – man denkt natürlich sofort an die amerikanische Gegenwart. Der Bezug zur McCarthy-Ära kristallisiert sich in der Person von Roy Cohn.
Roy Cohn: Bindeglied zwischen McCarthy und Trump
Der Jurist war in der ersten Hälfte der 50er Jahre die rechte Hand des Kommunisten und Schwule jagenden Senators Joseph McCarthy. Ein Vierteljahrhundert später ging dann ein New Yorker Immobilienmogul namens Donald Trump bei Roy Cohn in die Lehre (wie zuletzt in dem Spielfilm „The Apprentice“ zu sehen war).
Graf: ein unsicherer Kantonist für die DDR
Oskar Maria Graf – ein Kommunist? In der Wahnvorstellung von Rechtsextremisten allemal. Und was sagten die Kommunisten selber? Für die DDR war Graf kein Kommunist, sondern vielmehr ein unsicherer Kantonist. Ja, man druckte ihn in Ostdeutschland, auch „Unruhe um einen Friedfertigen“, bereits 1948, und auch nach der Staatsgründung etliche Male.

Bildnis Oskar Maria Graf (1927) von Georg Schrimpf.
Nicht nach dem Geschmack der SED
Doch richtig begeistert war man nicht. Schließlich hat Ludwig Allberger so seine Probleme mit der Kommunistischen Partei – ein strahlender kommunistischer Held, wie ihn sich die SED vorstellte, sah anders aus.
Im Westen: Keine Experimente!
In Westdeutschland erschien „Unruhe um einen Friedfertigen“ zu Lebzeiten des Autors vorsichtshalber gar nicht. Erst 1975 konnte sich ein Verlag in der Bundesrepublik dazu aufraffen, diesen gewichtigen Roman zu drucken.
„Zur Zeit nicht lieferbar“
Und jetzt scheint man in die alten ignoranten Zeiten zurückzufallen. Auf der Seite des Ullstein Verlags wird eine 2019 erschienene Taschenbuchausgabe für 15 Euro angepriesen, doch wenn man sie bestellen will, heißt es: „Zur Zeit nicht lieferbar“
Dichtung und Wahrheit
Dabei besticht „Unruhe um einen Friedfertigen“ durch seine intime Kenntnis sowohl des bayerischen Landlebens als auch der verhängnisvollen Jahre des Aufstiegs der Nazis. Alles an diesem Roman ist erfunden, und alles ist von einer historischen Wahrheít und Faktizität, an die selbst penibelste Geschichtsschreibung kaum heranreicht.
Geglättet, aber nicht glattgebügelt
Der Roman ist noch um einiges detaillierter, härter und kantiger als die (zum Beispiel um die Vorgeschichte) gekürzte und geglättete Verfilmung. Das soll kein Vorwurf sein. Das Drehbuch von Hannah Hollinger ist die bestmögliche Version, aus dem wuchtigen Roman einen dreistündigen Fernsehfilm für das Jahr 2025 zu machen.
Kriegsheimkehrer gegen Kriegsheimkehrer
Das zeigt sich nicht nur an dem freundlichen Duell zwischen Silvan Heingeiger sen. und Julius Kraus, also zwischen dem Bürgermeister und dem Schuster (Sigi Zimmerschied und Josef Hader). Sondern genauso an den feindlichen Kontrahenten Silvan Heingeiger jun. und Ludwig Allberger.
Waren die im gleichen Krieg? In der gleichen Armee?
Beide haben eben erst den Ersten Weltkrieg überlebt, beide waren Soldat nicht nur im gleichen Krieg, sondern auch in der gleichen Armee, haben auf der gleichen Seite gekämpft. Aber sie haben extrem gegensätzliche Schlüsse daraus gezogen.
Frieden? Was für Memmen!
Silvan Heingeiger meint ganz einfach, dass das jetzt auch daheim, im Frieden, so weitergeht, dass er herumkommandieren und morden darf nach Herzenslust. Schließlich ist er vier Jahre lang dafür gelobt und ausgezeichnet worden! Warum sollte das nun auf einmal anders sein?
Entmilitarisierung der Gesellschaft
Ludwig Allberger dagegen hofft, dass nicht nur das Morden jetzt endlich vorbei ist, sondern auch die autoritäre Zwangsherrschaft, die das Militär auszeichnet. Er setzt alles daran, dass der Obrigkeitsstaat einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung weicht, in der alle was zu sagen haben.
Untertanen oder mündige Bürger?
Silvan und Ludwig: Im Aufeinanderprallen dieser beiden noch relativ jungen Männer wird der Bürgerkrieg von 1918/19 auf den Punkt gebracht. Die Verjagung des bayerischen Königs und des deutschen Kaisers, die Ausrufung der Republik war nur möglich, weil viele aus dem Krieg heimkehrende Soldaten das verlangten.
Wessen Krieg war das eigentlich?
Sie hatten die Schnauze voll von diesem Krieg, nicht weil Deutschland ihn verloren hatte, sondern weil sie erkannt hatten, dass es nicht ihr Krieg gewesen war, weil sie die patriotische Verklärung von Mord und Totschlag nicht mehr hinnahmen.
Die Revolution als Verbrechen
Doch für viele andere Kriegsheimkehrer war der Sturz der Monarchie eine Meucheltat von Verrätern, denen man den Garaus machen musste. Wenn schon der Krieg verloren war, dann sollte wenigstens die „gute, alte Ordnung“ bewahrt werden!
Die Republik als ehrlose Veranstaltung
Sie wollten als Helden gefeiert werden, die als treue Untertanen ihre Pflicht erfüllt hatten. Niederlage hin oder her, sie hatten doch nicht für König, Kaiser und Vaterland gekämpft, um am Ende ohne König und Kaiser dazustehen, und statt einem stolzen Vaterland nur mit einer lumpigen Republik!
Die Dampfwalze zermalmt alles
Aber um noch mal auf das vom Schuster Julius Kraus so gefürchtete „A-bopa“ zurückzukommen: Am Ende, auf der letzten Seite des Romans von Oskar Maria Graf, heißt es: „Ohne dass sie es wollten und wussten, war das A-bopa zum Leben überhaupt geworden, und es war überall! Es äußerte sich nur verschieden, aber es löschte mit der Zeit alles Natürliche und Eigentümliche der einzelnen Menschen aus.“ Und der vorletzte Satz lautet: „Alles verschlang das hemmungslos entfesselte A-bopa.“
Trackback von deiner Website.