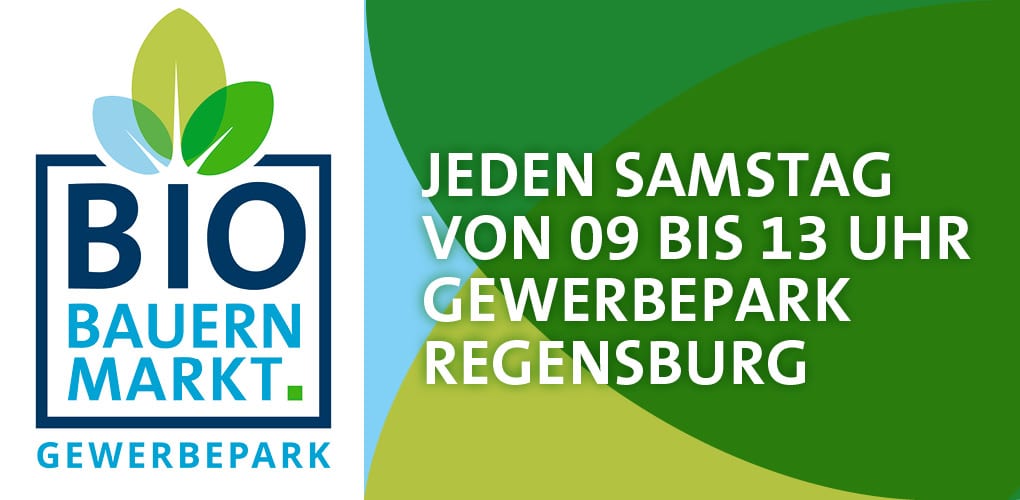Morgen, Regensburg! Was Hendrik Streeck mit Regensburg zu tun hat

1. Zweiter Podcast online
Letzte Woche haben wir – Adam Lederway, Martin Oswald und ich – uns im Studio von Ghost Town Radio wieder mal eineinhalb Stunden lang unterhalten – Regensburg Analog. Gleich hier unten kann man die Aufzeichnung der Sendung nachhören. Unter anderem geht es um das Wiedamann-Haus in der Brückstraße, das Biotop am Keilberg, darum, warum mir manche Kommentare im Forum auf die Nerven gehen und natürlich um den Brandanschlag der Antifa aufs Thurn-und-Taxis-Jagdschloss, den es überhaupt nicht gab.
Ich habe mich letzte Woche übrigens wahnsinnig darüber gefreut, dass unser Bericht zum Brand und den Auswürfen von Nius, Gloria, Kittel und Co im Newsletter von Übermedien erwähnt wurde.
Es ist das wichtigste deutschsprachige Medium für Medienkritik und ausdrücklich nicht nur für Journalistinnen und Journalisten empfehlenswert. Wer dort für kleines Geld ein Abo abgeschlossen hat, der konnte im Newsletter sogar besagte Erwähnung lesen.
2. Das harte Ja

„Das harte Ja“. Buch des Euthanasie-Propagandisten Florian Seidl.
Diese Woche musste ich an die 90er Jahre denken, genauer gesagt an das Jahr 1999. An die Debatte, um die Umbenennung der Florian-Seidl-Straße, gegen die sich die CSU lange sperrte. Erfolglos. Seit 26 Jahren heißt sie Johann-Hösl-Straße.
Mir geht es aber nicht um die nach wie vor mühsame Diskussion über das Für und Wider von Straßenumbenennungen, das wird mal ein eigenes Thema, sondern um ein Buch, das Seidl 1933 im Zentralverlag der NSDAP veröffentlicht hat: „Das harte Ja“.
Darin bejubelt der gebürtige Regensburger die Ermordung und Sterilisation von Behinderten und Kranken zum Wohle der Volksgemeinschaft. Und es wäre noch einmal ein eigenes Thema wert, dass CSU-Oberbürgermeister Hans Herrmann (ehemals BVP, ehemals NSDAP) dem auch nach dem Krieg stramm rechtsextremen Seidl die Albertus-Magnus-Medaille verlieh und dass die Ehrung mit einem Straßennamen erst 1973 erfolgte.
An Seidl denken musste ich aber angesichts der Wortmeldung von Hendrik Streeck, seines Zeichens Drogenbeauftragter der aktuellen Bundesregierung und Profiteur des Nepotismus von CDU-Fraktionschef Jens Spahn (kann man hier bei Correctiv nachlesen).
Streeck hat, irgendwie humanistisch mit einer Anekdote um seinen sterbenden Vater verbrämt, die Versorgung älterer Menschen mit Medikamenten unter Kostenvorbehalt gestellt. Die Welt, ehemals seriöses konservatives Medium, jetzt stellenweise an eine Zeitung aus dem Verlag von Alfred Hugenberg erinnernd, sprang sekundierend mit Bilanzen zum Gesundheitswesen bei.
Mittlerweile fühlt Streeck sich missverstanden. Es ginge ja nicht ums Sparen, sondern ums Ersparen, schreibt der 48-Jährige nun. Das ist natürlich ein Thema, Chemotherapien beispielsweise, die dem Patienten nichts mehr bringen, ihm aber auch noch die letzten Wochen versauen. Doch das war nicht Kern von Streecks erster Wortmeldung in dieser Sache.
Gegenüber Welt-TV erklärte er mit Verweis auf die Kosten klipp und klar und die Entscheidungsfreiheit des Patienten missachtend: „Es gibt einfach Phasen im Leben, wo man bestimmte Medikamente einfach so nicht mehr benutzen sollte.“ Zum Beispiel bei einem 100-Jährigen. Das falle unter die medizinische Selbstverwaltung.
Unabsichtlich oder nicht, ob nun aus Dummheit oder Kalkül hat Streeck sich mit solchen Äußerungen in die unselige Tradition Seidls gestellt, der den Wert menschliches Leben einem Kosten-Nutzen-Faktor unterworfen hat und so eben – die letzte Konsequenz dieser Denkweise – zu einem „Harten Ja“ für Massenmord kam.
Wobei ich Streeck nicht Seidls Ideologie unterstellen möchte – der war ein überzeugter Nazi. Streeck scheint das Thema Menschenwürde eher aufgrund einer Mischung von Profitdenken und Selbstüberschätzung hintangestellt zu haben. Brandgefährlich und geschichtsvergessen ist das trotzdem.
Früher sind Politiker oder deren Anhängsel wegen geringfügigerer Missverständnisse schon mal zurückgetreten. Aber wir leben ja nicht mehr in den 90-ern.
3. Träume kann man nicht verbieten
Weil ich gerade bei früher bin. Diese Woche war ich bei einem Presstermin zur aktuellen Tournee der Traumfabrik, der bisher längsten quer durch ganz Bayern – unter Regie von Ingo Pawelke. 45 Jahre ist die Traumfabrik jetzt alt, gegründet von Vater Rainer Pawelke.
Anfang der 2000-er habe ich, damals noch fürs Wochenblatt, die Traumfabrik betreut, sprich: PR-Texte geschrieben und die Kartenverlosungen ins Werk gesetzt, mit denen man sich bis heute behilft, ganz ohne teure Werbeanzeigen.

Braucht dringend einen Namen: das Maskottchen der Traumfabrik im Hintergrund. Vorne: die argentinische Artistin Popi. Foto: as
Heuer kann man übrigens unter anderem Karten gewinnen, wenn man der Wappenfigur einen Namen gibt – fünf Tickets gibt es für den Siegervorschlag (schicken an ingo.pawelke@traumfabrik.de). Und tatsächlich braucht das Maskottchen dringend einen Namen. Beim Pressetermin hat die Künstlerin in dem Kostüm anfänglich so traurig ausgesehen wie die kindliche Kaiserin aus der Unendlichen Geschichte. Letztere musste sich ja auch ewig grämen, bis der nervige Bastian endlich ihren Namen ausgesprochen hat.
Das alles erwähne ich nicht, weil es dafür irgendeine Werbeanzeige gibt, sondern weil mir die Traumfabrik durchaus gefallen hat, als ich sie – lang ist es her – mal besucht habe. Vor allem aber, weil ich mich – damals beim Wochenblatt – noch gut daran erinnern kann, mit welchen Widerständen Rainer Pawelke an der Universität Regensburg zu kämpfen hatte.
Diverse Prozesse musste er führen, vor allem weil einem damaligen „ewigen Vizekanzler“, Altburschenschaftler und Linkenhasser auf Kommunistenjagd, die progressiven Ideen Pawelkes – Sport braucht keine andere Begründung als Spaß und Vergnügen – nicht gefielen. Man stritt sich über zwei Jahrzehnte. Die Uni ignorierte eine Grundsatzentscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, verlor regelmäßig Prozesse. Lang ist’s her.
Heute ist der Vizekanzler Geschichte und die Traumfabrik ein potentes Kulturunternehmen – was war das für eine Materialschlacht bei der Pressekonferenz. Die Kaffeetasse behalte ich. Früher war eben nicht alles besser.
4. Rudi Rallala
Dass wir in Ostbayern mit den Bischöfen Rudolf Voderholzer und Stefan Oster die reaktionäre Speerspitze der katholischen Kirche unser Eigen nennen können, ist ja weithin bekannt. Wie berichtet, waren die beiden ganz vorne dabei bei der Hetzkampagne gegen die Richterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf. Eine Notwendigkeit, etwas zu relativieren, weil man als Stichwortgeber für Rechtsextreme fungierte, sahen im Nachgang weder Oster noch Voderholzer.

Ein dynamisches Duo: Rudolf Voderholzer und Stefan Oster. Foto: Wikimedia Commons
Aktuell sind es nun wieder die beiden, die sich gegen ein Papier der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) zur Sichtbarkeit und Anerkennung der Vielfalt sexueller Identitäten in der Schule wenden.
Auf 58 Seiten („Geschaffen, erlöst und geliebt“) ruft die DBK zu einem wertschätzenden und achtsamen Umgang mit sexueller Vielfalt an Schulen auf. Kinder und Jugendliche sollten sich in der Suche nach ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität wahr- und ernstgenommen fühlen, heißt es darin.
Dieser Text spricht, das betonen Oster und Voderholzer einhellig, wieder einmal „nicht in meinem Namen“. Beide führen irgendwelche theologischen, philosophischen, pädagogischen und entwicklungspsychologischen Gründe an. Es darf halt nicht sein, was man sich unter seinem purpurnen Käppi nicht vorstellen kann.
Die epische Begründung Osters steht auch auf der Seite des Bistums Regensburg. Vielleicht gibt es hier im Forum ja ne theologische Debatte. Ich bin schon lange ausgetreten.
Entspannte Restwoche!
Trackback von deiner Website.