Zwischen Enthusiasmus, Hoffnung und Fatalismus – das war das Transit Filmfest
Ein stark reduziertes Festival, zum letzten Mal mit Chrissy Grundl als Leiterin. Beim Transit Filmfest gab es beeindruckende Filme, aber auch einen realistischen Blick auf die schwierige Situation der freien Kulturszene.

Vier Stunden lang verfolgten die Besucherinnen und Besucher die Arbeit auf einer Palliativstation. Sie begleiteten ein Mutter-Tochter-Gespann bei ihrem gar nicht so leichten Alltag in einer Wiener Sozialbausiedlung. Mit einem israelischen Pianisten ging es auf eine Suche nach sich selbst entlang der Grenze zu Gaza – nach dem 7. Oktober 2023. Und auf einem Podium wurde etwas vergeblich nach positiven Aussichten gefragt.
Das alles und noch einiges mehr war das Transit-Filmfest 2025 am vergangenen Wochenende. Das Orga-Team muss sich derweil neu aufstellen. Auf dem Bürgerfest hatte das Team des Transit-Filmfest diesen Sommer einen Stand aufgebaut. Auf einer Schreibmaschine konnte wer wollte tippen, wo man denn derzeit Druck verspüre. Chrissy Grundl, Leiterin des Filmfests, erinnerte am vergangenen Donnerstag zum Auftakt der diesjährigen Transit-Ausgabe noch einmal daran. Alles mögliche sei geschrieben worden. Und auch ein großes Dankeschön an das Team für die Arbeit der letzten Jahre, erzählte Grundl. „Jetzt wollen wir uns vier Tage einmal dem Druck stellen“, sagte sie dann.
Kino als kollektiver Erfahrungsraum
Dass das Transit diesmal deutlich kleiner ausfiel, sollte dabei kein Nachteil werden. Grundl hatte das „Kino als kollektiven Erfahrungsraum“ .angepriesen, in dem man sich gemeinsam der Welt da draußen stelle.

Chrissy Grundl übernimmt die Festivalleitung heuer zum letzten Mal. Alle Fotos: Transit Filmfest
Um das Ostentorkino auch ja nicht verlassen zu müssen, gab es im Innenhof einen kleinen Grillstand für Verpflegung. Die veganen Steaksemmeln waren dann teilweise schon nach einer Stunde ausverkauft und das Kino das gesamte Festival über wirklich gut besucht, wie Bastian Zieglgruber am Sonntagabend zwischen den letzten Filmen kurz anmerkte.
Selbst am Samstagvormittag hatten sich wackere Festivalgänger es sich auf den Sesseln bequem gemacht, bestenfalls mit reichlich Verpflegung ausgestattet und in möglichst bequemer Kleidung. Über vier Stunden hinweg gewährt Regisseur Philipp Döring in „Palliativstation“ Einblicke in eine solche Abteilung. Die Doku ist dabei erstaunlich kurzweilig. „Ich musste aufs Klo, aber konnte nicht entscheiden wann, aus Sorge, etwas im Film zu verpassen“, hatte eine Frau anschließend Döring ein Kompliment gemacht.
Wenn sich Zeit und Fokus verlagern
Dem Regisseur gelingt es hervorragend, zwischen Trauer, Angst und Tod vor allem die Menschen als Individuen einzufangen – indem er sie mit Worten, Mimik und Gestik sprechen lässt. Er habe bewusst auf das ständige und direkte Darstellen von Wunden und Toten verzichtet, erzählte Döring den Anwesenden. Stattdessen werden die Gespräche zwischen dem Stationsteam und den Patienten ausführlich gezeigt, die Kamera läuft auch bei einer teaminternen Runde, in der Probleme offen angesprochen werden. Wenn Hände gestreichelt und aufgelegt werden, ist die Kamera mit gebotenem Abstand dabei. Berührungen, die von Menschlichkeit zeugen, dort, wo es um das baldige Ende geht.

Regisseur Philipp Döring dreht zwei Monate lang auf einer Berliner Palliativstation.
Zwei Monate war Döring auf der Station. Er trug die blaue Kleidung, um möglichst wenig aufzufallen. Er war dabei, wenn Patienten aufgenommen wurden, gewann von vielen schnell das Vertrauen und durfte sie schließlich begleiten. Etwa die 39-jähriger Mutter, für die es keine Heilung mehr gab, die aber auf der Station noch einmal zu neuen Kräften kam. Oder eine ältere Dame, die schwer krank auf der Palliativstation den plötzlichen Tod ihres Mannes verkraften musste.
„Was mach ich mit der Zeit“, fragte ein älterer Mann den Arzt. Früher sei die nur so davon gerast. Und jetzt vergehe sie so langsam, dass der Mann bald gar kein Gespür mehr für sie hat. „Am Lebensende verlagert sich einfach der Fokus“, antwortet der Arzt dann einer Angehörigen, die daran verzweifelt, dass ihr Partner scheinbar schon mit vielem abgeschlossen hat.
Unaufgeregt und doch eindrücklich, das trifft sowohl auf „Palliativstation“, als auch auf den Eröffnungsfilm des diesjährigen Transit-Flmfests zu. Die Milieu-Studie „Wenn du Angst hast nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst“ begleitet die zwölfjährige Anna und ihre gehörlose Mutter Isolde durch ihren Alltag in Wien. Regisseurin Marie Luise Lehner gelingt es auf beeindruckende Weise, all die Probleme, mit denen die beiden Protagonistinnen zu kämpfen haben, zu erzählen – unaufdringlich und doch jederzeit sofort nachvollziehbar, meist ohne größere Worte. Dabei werden gleich mehrere Phänomene verarbeitet, die in unserer Gesellschaft omnipräsent und zugleich für viele kaum wahrnehmbar sind.
Zwischen Geldproblemen und dem Wunsch nach Zuneigung
Getreu dem Transit-Motto 2025 „Under Pressure“ werden Anna in ihrer neuen Klasse am Gymnasium schnell die sozialen Unterschiede vorgehalten. Da sind die Markenklamotten, die die anderen tragen. Also leiht sich Anna von einer Bekannten einen gefälschten Pullover. Da ist die Ski-Fahrt, an der Anna natürlich teilnehmen will. Doch dann steht da plötzlich die neue Schlafcouch in der engen Wohnung. Ihre Mutter hat beschlossen, dass Anna mit zwölf Jahren endlich ein eigenes Bett braucht. Oder hat sie da doch mehr ihren neuen Partner im Blick gehabt?
Die beiden Frauen müssen zwischen dem Wunsch nach Zuneigung, der beginnenden Pubertät, der Suche nach der eigenen Identität und zwischen finanziellen Schwierigkeiten doch stets zusammen halten. Eindrücklich zeigt sich das, wenn sie im Schwimmbad sind, Isolde ihr Hörgerät rausnimmt und auch für die Zuschauer all die Geräusche kurz verstummen. Für einen kurzen Moment ist sämtlicher Druck weg und die Mutter kann im Wasser treiben – auf den Händen ihrer Tochter, die mit zwölf Jahren doch schon einiges mit sich herumzutragen hat.
Auf dem besten Weg, abzustürzen
Das Transit-Filmfest ist nicht bekannt für Goodfeel-Movies, für seichte Komödien oder klassisches Action-Gedöns. Seit 2019 bereits, als man das Heimspiel-Fest transformierte, widmet sich das Team Jahr um Jahr aufs Neue der Gesellschaft im Transit. Wo stehen wir gerade, was treibt uns alle um und wo geht es hin? Bei einer Podiumsdiskussion am Freitagabend war die Antwort darauf keine sonderlich optimistische. Schließlich sei das System kaputt und die Gesellschaft auf dem besten Wege, abzustürzen. So hatte es Sarah Waterfeld gesagt.

Sara Waterfeld übt Kritik am Intendanten-System.
Die Autorin („Sex mit Gysi“ und „Was vom Hummer übrig blieb“) war 2017 an der Besetzung der Berliner Volksbühne beteiligt. Die richtete sich damals gegen den neuen Intendanten. Waterfeld hat eine klare Meinung zum Kulturbetrieb in seiner derzeitigen Form. Intendanten seien eine Art moderne Monarchen, die zu viel Macht hätten. Waterfeld plädiert mit ihrer Initiative „Union für Cultural Commons“ für einen radikalen Umbau der Kulturinstitutionen. Entscheidungen sollten nicht von einigen wenigen getroffen werden.
Rechte Kräfte contra freie Kulturszene
Große Hoffnung äußerte Waterfeld nicht. Auch weil das Erstarken rechter Kräfte gerade der freien Kulturszene mehr und mehr zusetze. Der Wind habe sich stark gedreht, darüber herrschte auf dem Podium Einigkeit. Der Leipziger Musiker und Regisseur und Kameramann Achim Kolba sprach davon, wie die AfD in Sachsen inzwischen regelmäßig die Auszahlung von Fördermitteln blockiere und damit Teile der Kultur immer wieder lahmlege. Weil das die nächsten Jahre kaum besser werde, müsse man sich eigene Freiräume schaffen, sagt Kolba. Er selbst ist seit 2020 Teil des DIY-Fernsehstudios Hitness Club. Man müsse mehr auf Spenden setzen, anstatt sich weiter auf Förderungen zu verlassen.
Eine solche Förderkulisse stellt seit nunmehr zehn Jahren das Bundesprogramm Demokratie Leben dar. Christoph Seidl ist bei der Stadt Regensburg hierfür verantwortlich und kennt daher die Förderpraxis. Die habe sich zuletzt noch einmal verändert. Inzwischen muss eine Gemeinnützigkeit belegt werden. Dazu brauche es aber Vereine oder Stiftungen, nicht alle Kulturschaffenden könnten das leisten. Mit der inzwischen geltenden Teilnehmerpauschale hätten Veranstalter zudem nun ein hohes finanzielles Risiko zu tragen. Seidl sagte, Förderrichtlinien seien immer auch ein Schutzfaktor, vor Angriffen von außen. Es gebe Kräfte, die mittlerweile ganz genau hinschauen, was gefördert wird und wo möglicherweise interveniert werden könne.
Karriere im Kulturbetrieb muss man sich leisten können
Unabhängig von Fördermitteln stehe die Kulturbranche aber auch vor einem ganz grundlegenden Problem, wie nicht nur Andrea Kuhn betonte. Die Bezahlung von Kulturschaffenden sei kaum zu rechtfertigen. Kuhn leitet seit 2007 hauptberuflich das Internationale Nürnberger Filmfestival der Menschenrechte. Sie habe durch ihre Anstellung, die teils städtisch gefördert wird, in einer durchaus privilegierten Situation, sagte Kuhn. Dass Praktika oft unbezahlt seien, stelle eine Hürde da. Im Kulturbetrieb Karriere zu machen, das müsse man sich schon selbst leisten können. Kuhn hat auch deshalb mit der Gewerkschaft Verdi die Initiative „Festivalarbeit gerecht gestalten“ gestartet.
Waterfeld, die ihre eigene Lage als „ultra prekär“ betitelte, riet trotz diverser Versuche, etwas zu verbessern, davon ab, auf eine Karriere im Kulturbetrieb zu hoffen. „Über 90 Prozent derjenigen, die in künstlerischen Berufen ausgebildet werden, werden nie von ihrer Kunst Leben können“, untermauerte Waterfeld ihren Punkt.
Screenlife-Version von Ocean’s Eleven
Bei Hope Elliott Kemp klang das am Sonntag hingegen etwas anders. Mit Ronan Corrigan stand sie nach ihrem gemeinsamem Film „Lifehack“ noch Rede und Antwort. Der ist gewissermaßen eine Screenlife-Version von Ocean’s Eleven. Das heißt: Der gesamte Film erzählt einzig per Desktop- und Smartphone-Bildschirmaufnahmen, wie vier junge Computer-Geeks, die gerne mal Online-Betrügern das Handwerk legen, auf die leicht arrogante Idee kommen, sich mit einem Bitcoin-Mogul anzulegen. Nachdem zunächst alles wunderbar klappt, geht dann doch einiges schief. Letztlich endet für das Quartett aber alles doch noch im Guten.
Fünf Jahre haben Kemp und Corrigan an „Lifehack“ gearbeitet. Sie hätten viel recherchiert und auch mit den großen Tech-Konzernen Kontakt – über Hacker-Angriffe, im Speziellen von Jugendlichen. Schließlich quartierte sich das „tiny, tiny Team“ (Kemp) zwei Wochen in einem „schrecklichen Hotel“ für die Dreharbeiten ein. Als sie darüber sprach, wie sie für ihren Film „Lifehack“ über ein Jahr allein für die Finanzierung gebraucht hätten, ermutigte Kemp potenzielle Filmemacher im Saal aber auch. Selbst wenn sie ihr eigener Film immer wieder habe verzweifeln lassen während des Prozesses, so liebe sie doch das Ergebnis und sei es eine tolle Zeit gewesen.
Chrissy Grundl gibt die Leitung ab
Eine tolle und doch immer wieder herausfordernde Zeit hatte Chrissy Grundl die letzten Jahre. Als Festival-Leiterin sprach sie am Donnerstag aber zum letzten Mal die eröffnenden Worte und dankte zum letzten Mal der Stadt Regensburg – von der diesmal niemand da war – und der Sparkasse – die zumindest ihr Logo mit Glückwünschen per Foto auf der Leinwand schickten – für die Unterstützung. So ein Festival ausschließlich im Ehrenamt zu stemmen, sagte Grundl, das sei auch trotz des tollen und engagierten Teams auf Dauer einfach kaum möglich. Die Filmauswahl, das Kuratieren des Programms, die Bewerbung, diverse Orga-Aufgaben, das alles koste viel Zeit.
Hinzu kommt etwas, das das Transit zu einem durchaus besonderen Festival macht: Die enge Zusammenarbeit mit der Fakultät für Medienwissenschaften der Uni Regensburg. Das Transit versteht sich auch als Testfeld für Studierende, die einmal selbst im Kulturbereich tätig werden wollen – sofern sie von Waterfeld nicht komplett abgeschreckt wurden. „Seit 2019 haben wir 71 junge Menschen an die Filmszene herangeführt“, sagte Grundl vor vollem Kinosaal. Diese zu fördern sei der „Löwenanteil“ der Festivalleitung gewesen. Mittlerweile seien viele bei größeren Events gelandet, sagte Grundl durchaus stolz.
Nun sei es aber an der Zeit, sich zurückzuziehen, auch um wieder Kraft zu tanken, erklärte die Medienwissenschaftlerin. Das Transit werde es weiter geben, versicherte Grundl. Das Team werde wieder ein tolles Event auf die Beine stellen. Nur in welcher Form, das ist aktuell noch offen.
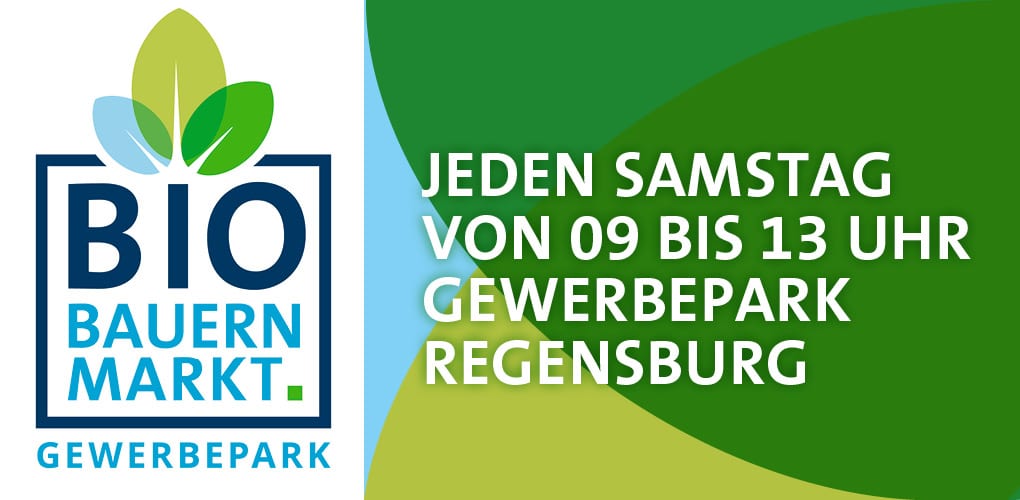

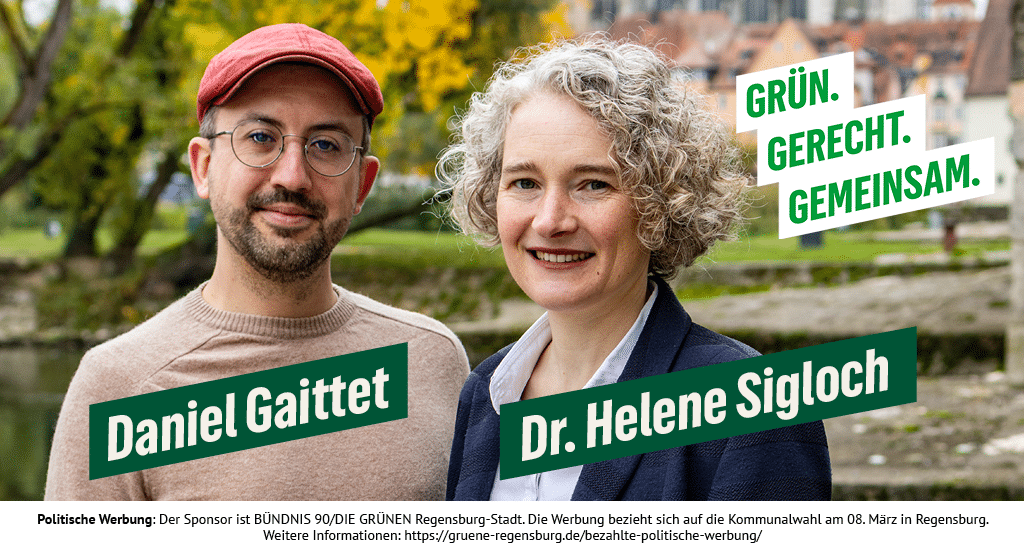



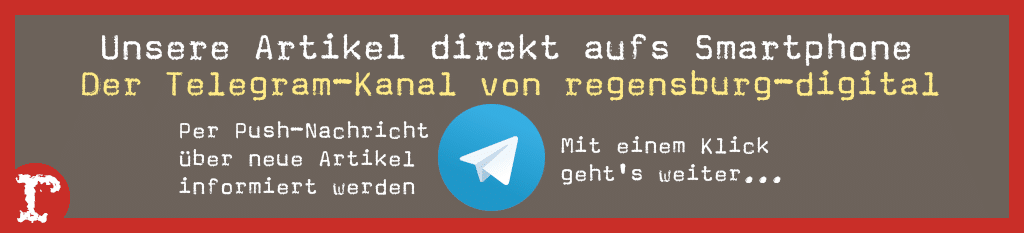

Hindemit
| #
Chrissy Grundl und ihr Team haben einen wirklich großen Impuls in den letzten Jahren für Regensburg gesetzt. DANKESCHÖN!
Kinogucker
| #
Es ist eine Schande, dass von der Stadt niemand da war. Das Transit-Filmfest ist eine der wenigen kulturellen Veranstaltungen in Regensburg, die mich noch hinterm Ofen hervor lockt. Lässt sich kein Förderverein dafür gründen? Die Idee hatten die Veranstalter bestimmt auch schon, ich frag mich nur.
Jakob Friedl
| #
@Kinogucker
Bei der Eröffnung waren diesesmal keine Bürgermeister*innen, Abgesandte, Referent*innen, Amtsleiter*innen etc da, z.B. um ein Grußwort zu sprechen. Da haben sie neben einer tollen Rede vor allem einen unvergesslichen Film und ein besonderes Konzert verpasst… Bei der Diskussionsveranstaltung war passend zum Thema u.a. Carolin Binder vom Kulturamt im Publikum, die bezüglich städtischer Kulturförderungen berät. Interessante Podiumsteilnehmer*innen! Schaut Euch z.B. den Hitnessclub an: https://hitness.club/
Yvonne
| #
Die Verantwortlichen der Stadt, arbeiten 24/7 an Konzepten für mehr Sozialwohnungen, Obdachlosenunterkünften und Spendenaufrufen für das zusätzliche Frauenhaus. Die haben keine Zeit, im Kino rumzuhängen. 😁😉😘 Also das muss der Grund für die Abwesenheit sein. Ein anderer fiele mir nicht ein.