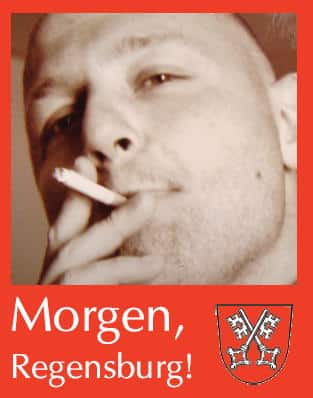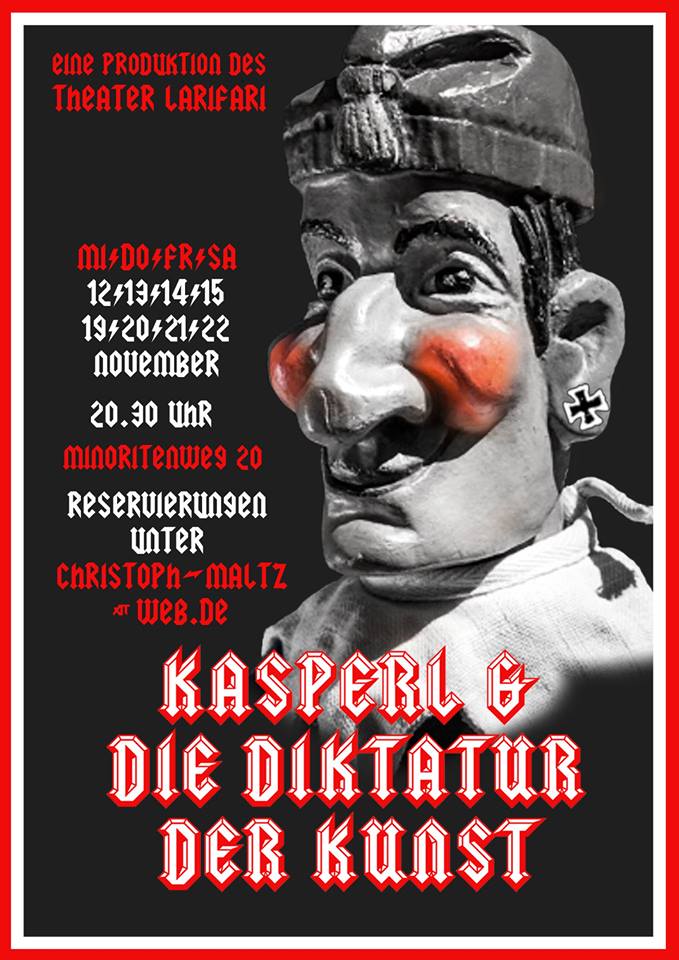Bewohnerin klagt – gegen Wohnbebauung
Die Stadt lässt in einem gerichtlich festgestellten Gewerbegebiet Wohnungen bauen. Jetzt wurde sie verklagt – von einer Anwohnerin.

Einem nicht rechtskräftigen Urteil des Verwaltungsgerichtes Regensburg zum Trotz vergibt die Stadt Wohnbaugenehmigungen. Jetzt wurde sie verklagt. Foto: Archiv.
Ein „bodenlos interessanter Fall“ sei das, sagt Wolfgang Seign, der Vorsitzende Richter der 2. Kammer am Verwaltungsgericht Regensburg. Einigermaßen kurios mutet die Streitsache, die am Donnerstag verhandelt wird, schon an – in mehrerlei Hinsicht.
Eine Frau klagt gegen die Stadt Regensburg, weil sie ein Gebäude auf ihrem Nachbargrundstück verhindern will. Soweit nichts ungewöhnliches. Als Argumente führt sie unter anderem an, dass die Baugenehmigung nicht bestimmt genug sei und gegen das „Rücksichtnahmegebot“ verstoße, weil das neue Gebäude eine „erdrückende Wirkung“ entfalte. Dabei soll der neue Bau nur ein Geschoss höher sein als das Haus der Klägerin und außerdem über ein Flachdach verfügen.
Wohnbebauung sei gebietswidrig
Ihr eigentlicher Einwand – „Jetzt kommen wir zum Fall!“, ruft Richter Seign – ist aber, dass auf dem Grundstück überhaupt keine Wohnnutzung erlaubt sei. Bei der Gegend handle es sich nämlich um ein „faktisches Gewerbegebiet“, Baugenehmigungen für Wohnhäuser seien damit gebietswidrig. Das Wohnhaus der Klägerin stehe seit 102 Jahren und sei deshalb „bestandsgeschützt“.